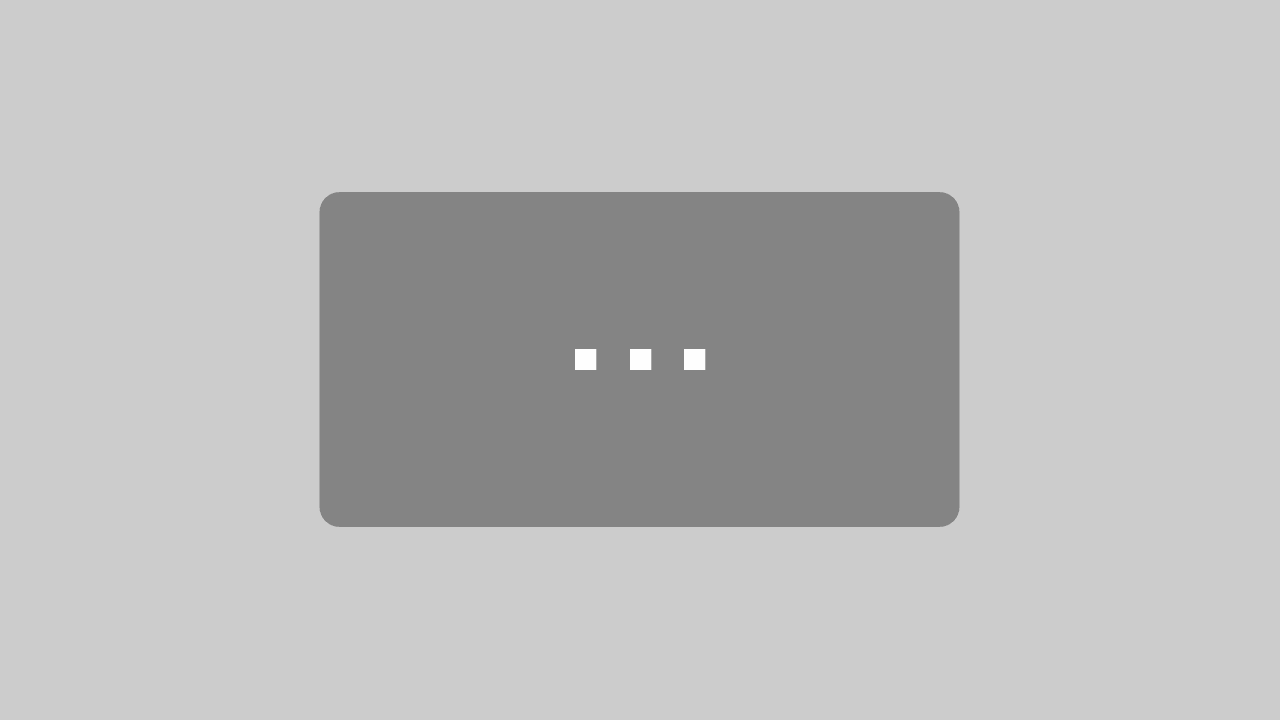24.11.2020
Interview mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der Aargauer Zeitung vom 7. Oktober 2020
Aargauer Zeitung: „Der Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungsinitiative ist eine Millionenschlacht: Bundesrätin Karin Keller-Sutter hält die Vorlage für «radikal». Sie erklärt, warum der Gegenvorschlag zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt ausreiche.“
Die Rollenverteilung im Abstimmungskampf ist klar: Hier die Guten, da die Bösen. Kann man denn guten Gewissens gegen diese Initiative sein?
Karin Keller-Sutter: Ja, das kann man. Der Bundesrat und das Parlament teilen die Ziele der Initiative, nämlich die Stärkung der Menschenrechte und des Umweltschutzes. Aber die Initiative ist zu radikal. Das Parlament hat einen indirekten Gegenvorschlag beschlossen, der die Anliegen aufnimmt, aber Schweizer Firmen nicht benachteiligt.
Die Plakatkampagne der Initianten stellt eine Glencore-Mine ins Zentrum – wenn der Konzern in Peru Kinder vergifte, solle er auch dafür geradestehen. Was können Sie da entgegenhalten?
In diesem Abstimmungskampf geht es um Emotionen. Deshalb ist es mir wichtig zu sagen: Der Bundesrat möchte die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen, um Umwelt- und Menschenrechtsstandards durchzusetzen. Aber wir stimmen nicht über den Titel der Initiative oder eine Idee ab. Sondern über die rechtlichen Instrumente, die zur Anwendung kommen würden. Und da muss man einfach sagen: Die neue Haftungsbestimmung der Initiative ist weltweit einmalig.
Es entspricht dem gesunden Menschenverstand, dass Schweizer Konzerne auch für Fehlverhalten im Ausland haften.
Unternehmen haften bereits heute!
Aber sie haften für sich selbst und dort, wo sie den Schaden angerichtet haben. Gerade kürzlich gab es einen Fall in Sambia, wo ein Minenbetreiber wegen Luftverschmutzungen verurteilt worden ist. Mit der Initiative würde ein Unternehmen neu für rechtlich eigenständige Töchter, Filialen oder wirtschaftlich abhängige Firmen haften.
Das heisst zudem: Ein Regionalgericht in einem Kanton müsste nach Schweizer Recht eine Verfehlung in einem afrikanischen Land beurteilen. Das ist in zweierlei Hinsicht problematisch.
Bitte?
Einerseits ist die Beweiserhebung schwierig. Andererseits zwingen wir einem anderen Staat Schweizer Recht auf. Die Schweiz hat sich immer gewehrt, als die Amerikaner ihre Rechtsordnung hier durchsetzen wollten. Die Initiative will nun aber genau das: Dass Schweizer Recht von Schweizer Gerichten auf Sachverhalte in anderen Ländern angewendet wird. Das ist ein Eingriff in die Souveränität.
Moderner Rechtsimperialismus?
Ich formuliere es anders: Die neutrale Schweiz kommt plötzlich auf die Idee, dass ihre Rechtsordnung überlegen ist. Ich finde es anmassend, dass mit der Initiative die Schweiz ihr Recht auch international durchsetzen würde.
Die Schweiz hat sich dazu verpflichtet, Geschädigten den Zugang zu Schweizer Beschwerdemechanismen zu ermöglichen, wenn hier ansässige Unternehmen an Menschenrechtsverletzungen im Ausland beteiligt sind und Betroffene im Gaststaat keinen angemessenen Zugang zu wirksamer Abhilfe erhalten. Was macht die Schweiz zur Wiedergutmachung?
Wir haben mit dem «Kontaktpunkt» beim Staatssekretariat für Wirtschaft einen Konfliktlösungs- und Vermittlungsmechanismus. Das ist der Schweizer Weg: Dialog statt Klage.
Der «Kontaktpunkt» hat eine andere Funktion als eine Haftungsklage: Er ist zukunftsgerichtet, es gibt keine Entschädigungen. Bei der Initiative geht es um die Vergangenheit, um Wiedergutmachung.
Die Entschädigung gibt es schon heute. Gegen jedes Unternehmen kann man klagen, aber nach nationalem Recht. Und die Entschädigung wird nicht nach Schweizer Standard ausgerichtet.
Und wenn das Rechtssystem in einem Land Defizite hat: Sehen Sie dann keinerlei Verantwortung für den Schweizer Mutterkonzern oder gar den Bund?
Wenn es Defizite gibt in einem Rechtssystem, müssen sie vor Ort behoben werden. Kehren wir das Ganze doch einmal um: Es könnte auch jemand sagen, es gebe Defizite im Schweizer Rechtssystem und ein anderer Staat könnte in der Schweiz in verschiedenen Bereichen sein Recht durchsetzen.
Was bringt der Gegenvorschlag?
Der Gegenvorschlag nimmt Unternehmen in die Pflicht und schafft Transparenz. Nehmen Sie die Kinderarbeit: Ein Unternehmen muss über die gesamte Lieferkette hinweg dokumentieren, dass es die Sorgfaltspflichten einhält. Es muss belegen, dass es alle Vorkehrungen getroffen hat, dass keine Kinder zu Schaden kommen. Das ist nicht nichts.
Der Gegenvorschlag beschränkt die Sorgfaltspflichten auf Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Weshalb?
Weil diese zwei Themen besonders heikel sind. Schweizer Unternehmen müssen eine Lieferkettenpolitik festlegen, sie müssen die Risiken ermitteln und Massnahmen ergreifen, um sie zu minimieren. Wir wollten, dass der Gegenvorschlag im Unterschied zur Initiative international abgestimmt ist. Es gibt eine EU-Richtlinie im Bereich der Konfliktmineralien. Die Kinderarbeit war mir persönlich ein besonderes Anliegen.
Was bringen Sorgfaltspflichten für Kinderarbeit bei einem Unternehmen, wo die Belastungen für die Umwelt ein grosses Problem sind?
Bei der Berichterstattung deckt der Gegenvorschlag auch den Bereich der Umwelt ab. Er geht hier noch weiter als die Initiative, weil wir auch die Korruption und Arbeitnehmerbelange drin haben. Der Geist des Gegenvorschlages ist der Schweizer Kompromiss: Wir wollen das machen, was andere änder auch tun. Der Gegenvorschlag ist international abgestimmt.
Gemäss dem Gegenvorschlag müssen Unternehmen die Berichterstattung ausbauen. Was bringt das – ausser neuer Hochglanzbroschüren?
Mehr Transparenz! Unternehmen stehen unter Beobachtung. Wer gegen die Berichterstattungspflicht verstösst, kassiert nicht nur eine Busse bis zu 100 000 Franken, er muss auch einen Reputationsschaden befürchten. Die Reputation ist das höchste Gut, das ein Unternehmen hat. Ein Beispiel: Ein Schweizer Schokoladenhändler wurde unlängst öffentlich dafür geächtet, weil der Besitzer sich mutmasslich negativ über Homosexuelle geäussert haben soll. Kunden blieben aus, Lieferanten kündigten Verträge, es gab negative Schlagzeilen.
Dank der Initiative könnten Geschädigte vor einem Schweizer Zivilgericht auf Schadenersatz klagen. Was haben Geschädigte vom Gegenvorschlag?
Opfer von Umweltverschmutzungen oder Menschenrechtsverletzungen können heute schon jederzeit vor Ort klagen, wenn sie geschädigt werden. Wie gesagt: Es ist nicht so, dass es keine Haftung gibt. Man muss sich aber fragen, was Menschen in den betroffenen Staaten davon haben, wenn die Initiative angenommen wird.
Nämlich?
Schweizer Unternehmen, die mit ihren Investitionen und Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen leisten, könnten sich aus Angst vor einer Rufschädigung zurückziehen. Man kann sich fragen, wer dann in die Lücke springt. Der Rohstoffabbau etwa ist gerade für chinesische Firmen sehr interessant, an Kreditvergaben oder Investitionen werden von diesen mitunter gar keine Bedingungen gestellt. Man sollte bedenken, dass Schweizer Unternehmen allein in Afrika über 60 000 Menschen beschäftigen.
Die Europäische Union denkt ihrerseits über neue Sorgfaltspflichten mit Sanktionen nach. Gerät die Schweiz nicht ohnehin ins Hintertreffen – wie einst beim Bankgeheimnis?
Dieser Vergleich hinkt etwas. Das Bankgeheimnis war ja eine Art Alleinstellungsmerkmal der Schweiz. Bei dieser Initiative bewegen wir uns jedoch im internationalen Rahmen und müssen darüber sprechen, ob wir Wettbewerbsnachteile für Schweizer Firmen in Kauf nehmen wollen. Der indirekte Gegenvorschlag setzt da an. Er forciert die internationale Zusammenarbeit, damit die Regeln aufeinander abgestimmt sind. Gibt es internationale Entwicklungen, steht es dem Gesetzgeber frei, diese aufzunehmen.
Der Schweiz stünde es aber auch frei, den Takt der internationalen Gesetzgebung zu bestimmen.
Was Sie als «den Takt bestimmen» bezeichnen, ist ein Nachteil für den Standort Schweiz. Im Initiativtext steht nichts von Konzernen, er betrifft grundsätzlich alle Unternehmen. Wir sprechen hier nicht nur über Konzerne, sondern auch über KMU. Gemäss einer Studie sind etwa 80 000 Unternehmen betroffen, wovon wiederum 80 Prozent weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Gleichzeitig bezahlen international tätige Unternehmen hierzulande fast die Hälfte der Unternehmenssteuern des Bundes. Umso wichtiger ist es, den Schweizer Weg zu wählen: International im Takt unterwegs zu sein – gemeinsam mit den anderen.